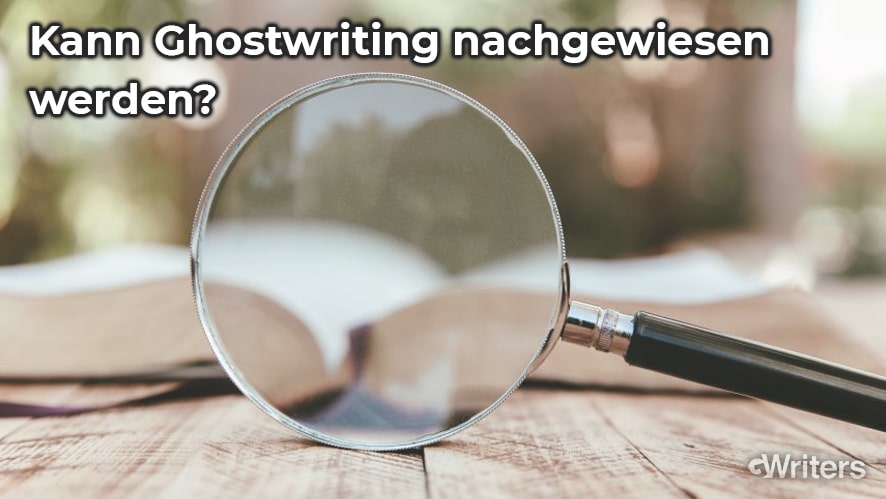Ghostwriting ist in vielen Bereichen etabliert – ob in der Wissenschaft, im Business oder im literarischen Umfeld. Doch sobald das Thema im akademischen Kontext zur Sprache kommt, stellt sich schnell eine zentrale Frage: Kann man Ghostwriting nachweisen? Und wenn ja – wie zuverlässig sind die Methoden, mit denen Hochschulen oder Softwareanbieter versuchen, Ghostwriting zu enttarnen?
In diesem Beitrag erfahren Sie, wie realistisch der Nachweis von Ghostwriting ist, welche Tools und Techniken verwendet werden, warum KI die Situation verändert und wie Ghostwriting rechtlich und ethisch zu bewerten ist. Abschließend werfen wir einen Blick auf typische Erkennungsversuche und wie Ghostwriter und Studierende damit umgehen können.
Was bedeutet es, Ghostwriting nachzuweisen?
Der Begriff „Ghostwriting nachweisen“ bedeutet, dass Dritte – etwa Lehrende, Prüfungsämter oder Gutachter – feststellen, ob ein wissenschaftlicher Text nicht vom offiziell eingereichten Autor verfasst wurde. Ziel ist es, Urheberfälschung oder Täuschung bei Prüfungsleistungen aufzudecken.
Der Nachweis ist dabei nicht mit dem reinen Verdacht zu verwechseln. Während ein Verdacht etwa durch einen plötzlichen Stilwechsel oder ungewöhnlich gute Qualität entsteht, erfordert ein tatsächlicher Nachweis objektive und belegbare Anhaltspunkte.
Warum ist es so schwierig, Ghostwriting nachzuweisen?
Die Herausforderung beim Ghostwriting-Nachweis liegt darin, dass:
-
der Ghostwriter den Text original verfasst (kein Plagiat),
-
die Schreibweise oft angepasst wird – an den Stil, das Vorwissen und das Niveau des Auftraggebers,
-
es keine öffentlich zugänglichen Datenbanken für Ghostwriting-Texte gibt,
-
viele Erkennungsmechanismen auf unsicheren Kriterien beruhen (z. B. Stilanalysen).
Im Gegensatz zum klassischen Plagiat, bei dem Textteile eins zu eins aus Quellen übernommen werden, ist ein Ghostwriting-Text ein Originaltext, der nicht einfach per Software erkennbar ist.
Ghostwriting nachweisen mit KI – funktioniert das?
In Zeiten von KI und Sprachmodellen wie ChatGPT hoffen viele Bildungseinrichtungen, auch Ghostwriting durch sogenannte KI-Detektoren nachweisen zu können. Doch hier liegt ein Missverständnis vor: Diese Tools erkennen nicht Ghostwriting, sondern KI-generierte Inhalte.
Ein professioneller Ghostwriter schreibt jedoch keine reinen KI-Texte, sondern arbeitet strukturiert, kreativ, individuell und wissenschaftlich. Wenn überhaupt KI-Tools genutzt werden, dann nur unterstützend, etwa zum Strukturieren oder Generieren von Ideen – nicht zur vollständigen Textproduktion.
Daher gilt:
KI-Detektoren können kein echtes Ghostwriting nachweisen. Sie sind auf ganz andere Inhalte trainiert.
Welche Methoden werden versucht, um Ghostwriting nachzuweisen?
Obwohl der eindeutige Nachweis oft schwerfällt, versuchen Hochschulen und Prüfer dennoch verschiedene Strategien, um indirekte Hinweise auf Ghostwriting zu sammeln:
a) Stilometrische Analysen
Diese Verfahren vergleichen den Schreibstil einer eingereichten Arbeit mit früheren Arbeiten desselben Autors. Dabei werden Merkmale wie Satzlängen, Wortwahl oder Komplexität untersucht. Doch solche Analysen sind sehr fehleranfällig – besonders bei kürzeren Textproben oder stark redigierten Arbeiten.
Ein veränderter Stil bedeutet nicht automatisch Ghostwriting. Studierende entwickeln sich weiter, holen sich Unterstützung, lernen neue wissenschaftliche Ausdrucksweisen oder investieren besonders viel Zeit in ihre Abschlussarbeit. Auch das Korrekturlesen durch Dritte oder die Verwendung von Tools zur Stilverbesserung kann zu stilistischen Veränderungen führen.
Daher gilt:
Eine stilometrische Abweichung ist kein Beweis, sondern höchstens ein Verdachtsmoment – und oft irreführend.
b) Plagiatssoftware
Plagiatsprüfungen helfen nur dann, wenn der Text aus öffentlich zugänglichen Quellen kopiert wurde. Ein Ghostwriting-Text, der individuell geschrieben wurde, wird von gängigen Programmen wie Turnitin, Plagscan oder iThenticate nicht als Plagiat erkannt.
c) Fachgespräche (Verteidigung der Arbeit)
Einige Hochschulen setzen auf Verteidigungsgespräche („Disputationen“), um zu prüfen, ob Studierende ihr Thema beherrschen. Wer dabei schwerwiegende Wissenslücken offenbart, macht sich verdächtig – doch auch hier handelt es sich meist nur um indirekte Indizien.
Doch auch diese Methode ist keineswegs ein sicherer Beweis für Ghostwriting. Viele Studierende bereiten sich sehr intensiv auf die Verteidigung vor – teils mit professioneller Hilfe.
Seriöse Ghostwriting-Dienstleister geben nicht nur einen fertigen Text ab, sondern bereiten ihre Kundinnen und Kunden strukturiert auf das Gespräch vor.
Dazu gehört beispielsweise:
-
eine strukturierte Zusammenfassung der zentralen Inhalte,
-
eine Stoffsammlung mit Argumentationslinien,
-
mögliche Rückfragen und passende Antworten,
-
sowie Tipps zur Präsentation und Gesprächsführung.
In vielen Fällen sind Studierende daher sehr wohl in der Lage, ihre Arbeit zu verteidigen – ganz gleich, ob sie mit Unterstützung erstellt wurde oder nicht.
d) Meta-Daten und Dateiverläufe
In Einzelfällen versuchen Prüfer, durch Office-Metadaten oder Dateiversionen Rückschlüsse auf den Autoren zu ziehen. Doch ein professioneller Ghostwriter wird solche Informationen entfernen oder neutralisieren.
Achtung: Natürlich gibt es auch schwarze Schafe, die sich als Ghostwriter ausgeben. Sie versprechen eine individuell erstellte Arbeit, liefern jedoch entweder eine bereits verwendete Vorlage oder eine schnell und unzureichend mit KI generierte Version. Deshalb ist es wichtig, sich im Vorfeld genau zu informieren:
Welche Erfahrungen hat der Ghostwriter? Gibt es verifizierte Bewertungen oder Referenzen?Am zuverlässigsten ist es, sich an eine etablierte Ghostwriting-Agentur zu wenden. Dort wird die Arbeit in der Regel von mehreren Fachkräften geprüft und als hochwertige Mustervorlage erstellt – unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Standards und fachlicher Korrektheit.
Wann ist ein Ghostwriting-Nachweis rechtlich relevant?
Entscheidend ist: Nicht jedes Ghostwriting ist automatisch rechtswidrig. In der Wissenschaft geht es v. a. um Prüfungsleistungen, die persönlich und eigenständig erbracht werden müssen. Wenn eine fremde Person den Text vollständig erstellt und der Studierende diesen als eigene Leistung einreicht, liegt eine Täuschung im Sinne der Prüfungsordnung vor.
Ein solcher Täuschungsversuch kann mit Sanktionen belegt werden, wenn er nachgewiesen wird – etwa durch:
-
ein Geständnis,
-
E-Mails oder Zahlungsnachweise,
-
eine Verbindung zu bekannten Ghostwriting-Plattformen,
-
massive inhaltliche Unstimmigkeiten.
Es ist jedoch zu beachten, dass diese Indizien allein nicht ausreichen, um einen Täuschungsversuch eindeutig nachzuweisen. Gerichte verlangen in der Regel objektive und stichhaltige Beweise, bevor sie Sanktionen verhängen.
Rechtliche Konsequenzen bei Nachweis von Ghostwriting
Sollte ein solcher Täuschungsversuch nachgewiesen werden, können folgende Sanktionen verhängt werden:
-
Strafrechtliche Sanktionen: Gemäß § 156 StGB kann die falsche Versicherung an Eides statt mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft werden.
-
Hochschulrechtliche Sanktionen: Je nach Hochschulordnung können Bußgelder bis zu 50.000 Euro, die Wiederholung von Prüfungsleistungen oder im schlimmsten Fall die Exmatrikulation drohen.
Warum professionelle Ghostwriting-Agenturen schwer nachzuweisen sind
Professionelle Ghostwriter achten darauf, dass die erstellten Texte:
-
individuell und auftragsbezogen verfasst werden,
-
keine Plagiate enthalten,
-
stilistisch zur Zielperson passen,
-
keine Rückschlüsse auf die Agentur oder den Autor zulassen.
Darüber hinaus wird der gesamte Auftrag meist vertraulich und anonym abgewickelt – mit Verschlüsselung, datenschutzkonformen Abläufen und diskretem Kundenservice.
Fazit: Ghostwriting nachweisen – möglich, aber selten erfolgreich
Das Ghostwriting nachweisen bleibt in der Praxis ein schwieriges Unterfangen. Zwar gibt es Methoden und Tools, doch sie liefern oft nur Indizien, keine Beweise. Insbesondere bei professionellen Ghostwriting-Dienstleistungen, die auf Individualität, Qualität und Diskretion setzen, sind Nachweise nahezu ausgeschlossen.